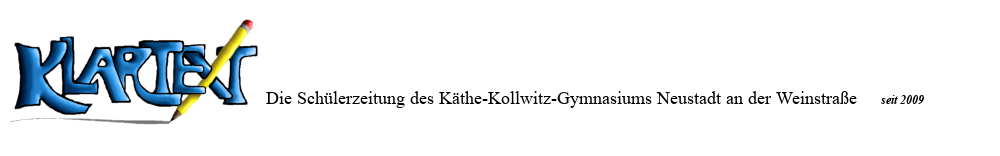„Vor Gott und der Geschichte ist mein Gewissen rein – Ich habe den Krieg nicht gewollt!“ Diese Behauptung stammt von Wilhelm II. (Deutscher Kaiser 1888-1918) und steht in krassem Gegensatz zu Artikel 231 des Versailler Vertrages, der 1919 festlegte: „Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, daß Deutschland und seine Verbündeten als Urheber aller Verluste und aller Schäden verantwortlich sind, welche […] infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben.“
Diese beiden gegensätzlichen Thesen waren Ausgangspunkt einer zweiwöchigen Projektarbeit des Geschichtsleistungskurses (MSS 12 G 2) von Herrn Hoffmann. Ziel war es, am Beispiel der Kriegsschuldfrage des Ersten Weltkriegs, sowohl einen vertieften Einblick in das historische Geschehen der so genannten „Julikrise 1914“ zu gewinnen, als auch die wissenschaftlichen Methoden eines Historikers intensiv in selbstständiger Forscherarbeit anzuwenden.
Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg sowie zur Zeit des Nationalsozialismus war eine rationale Diskussion der Schuldfrage nicht möglich. Entweder wurde die Verantwortung von deutscher Seite komplett geleugnet, oder man flüchtete sich in die verharmlosende Interpretation des Engländers Lloyd George, der vom „Hineinschlittern“ aller Staaten sprach. Bis in die ersten Jahre der Bundesrepublik Deutschland hinein hatte sich die deutsche Öffentlichkeit mit der entlastenden Deutung Lloyd Georges angefreundet und wurde erst 1961 durch die Veröffentlichung des Hamburgers Historikers Fritz Fischer „Griff nach der Weltmacht“ aus diesem „Dornröschenschlaf“ geweckt. Fischer entfachte mit seinen Thesen eine intensive und kontroverse Debatte („Fischer-Kontroverse“), die im Grunde bis heute anhält.
Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler bestand ebenfalls darin, eine eigene Antwort auf die Kriegsschuldfrage zu finden. Als Grundlage dienten zum einen Auszüge aus der wissenschaftlichen Sekundärliteratur (F. Fischer, K.-D. Erdmann, A. Hillgruber) und zum anderen zahlreiche Quellen (Briefe, Telegramme) aus der Auftaktphase des Ersten Weltkriegs, (so genannten „Julikrise“). Gerade diese Dokumente lieferten den Kursteilnehmern einen oft ungeschminkten Einblick in die Abläufe und Entscheidungen, die im Hintergrund der „großen Politik“ standen. Diese galt es inhaltlich und quellenkritisch auszuwerten. Die Ergebnisse sind im folgenden nachzulesen:
Die Situation in Europa im Sommer 1914 war wegen des Attentats in Sarajewo (28.6.1914) äußerst angespannt. Die Faktoren, die darauf einwirkten, bildeten sich schon Jahrzehnte zuvor und waren überwiegend durch die Kolonialpolitik, das Prestigedenken und die Verfolgung zahlreicher einzelner Interessen der Großmächte bedingt. Bereits am Anfang des 20. Jhd. wurden Bündnisse geschlossen, was davon zeugt, dass alle europäischen Staaten von einer eventuellen Kriegsgefahr ausgingen und sich auf diese Weise zu schützen beabsichtigten. Und obwohl die englische Regierung stets großen Wert auf die Erhaltung der balance of power legte, waren manche Länder in einer problematischeren Situation während der Julikrise, als die anderen.
Vor allem Deutschland befand sich in einer besonders ungünstigen Ausgangslage. Ab 1890 orientierte man sich an dem „neuen Kurs“ Wilhelm II. Dabei stand nicht mehr die Sicherheit Deutschlands im Vordergrund, sondern das Erreichen einer „Weltmachtstellung“ des Reichs. Die Außenpolitik nahm einen immer aggressiveren Charakter an und das defensiv gedachte Bündnissystem Bismarcks wurde nach und nach aufgelöst. Dadurch geriet Deutschland in fast vollständige Isolation, während Russland, England und Frankreich sich immer näher kamen. Die politische Führung in Deutschland war sich darüber im Klaren und glaubte sich diesen Umständen sinnvoll angepasst zu haben. Bereits 1905 wurde der sog. „Schlieffen-Plan“ für den Fall eines Zweifrontenkrieges entwickelt. 1911 äußerte sich der deutsche Generalstabschef v. Moltke dazu: „Man kann wohl mit Sicherheit annehmen, dass der nächste Krieg ein solcher nach drei Fronten sein wird“ (M1, Z.1). Auch ein Jahr später diskutierten Politiker mögliche Vorgehensweisen in einem bevorstehenden Konflikt: „Ich halte einen Krieg für unvermeidlich und: je eher, desto besser“ (M2, Z.22), wobei die Einzelheiten nicht klar definiert wurden (M2, Z.31). Zur Absicherung wurde allerdings beschlossen, das Volk durch die Presse auf einen eventuellen Kriegsfall vorzubereiten (M2, Z.25 und 33).
Die Person des Kaisers spielte am Anfang des 20. Jhd. eine bedeutende Rolle. Bei seinen Entscheidungen orientierte er sich an unbedachten Launen, die oft einen kriegerischen Charakter hatten. Es zeigt sich z.B. sehr deutlich an seinen Kommentaren zu einem Bericht des Botschafters Tschirschky. Dessen eher gemäßigten Aussagen werden vom Kaiser kritisiert und sogar als „sehr dumm“ (M3, Z.14) bezeichnet. Anhand dieser Stellungnahme wird die Position Wilhelms II. ersichtlich – für ihn war Krieg die einzig mögliche Option, die Deutschland in Betracht ziehen konnte.
Zum Zeitpunkt der Ereignisse im Juli 1914 war die Stimmung in der deutschen Regierung sehr ernst. Einerseits sollten sie ihren letzten Bündnispartner unterstützen, andererseits waren die Politiker doch zögerlich, da sie die Lage als sehr kritisch bewerteten. Der Außenminister v. Jagow vertrat die Meinung, dass das Bündnis mit Österreich sogar eher belastend sei („Wir haben nun einmal ein Bündnis mit Österreich…“ (M4. Z.1), doch da Deutschland keine anderen Optionen bei der Wahl der Partner zu dem Zeitpunkt bliebe, müsste der Bündnisfall eingehalten werden. Entscheidend war der darauffolgende „Blankoscheck“ der deutschen Führung, der den Partner dazu ermutigte, Serbien schnell anzugreifen, um die Situation auf dem Balkan zu stabilisieren. Dieser voreilige Entschluss prägte das Verhalten Deutschlands in der Julikrise.
Von nun an unternahm die Regierung demonstrativ mehrere Versuche, den Konflikt auf den Balkan zu lokalisieren. Am 29.7.1914 äußerte Reichskanzler Bethmann dem englischen Botschafter seinen Wunsch, den Frieden zu erhalten (M5, Z3). Dabei wurde versucht, Russland als den Hauptaggressor darzustellen: „Im Falle eines russischen Angriffs auf Österreich könnten Deutschlands Pflichten als Bundesgenosse Österreichs zu seinem großen Bedauern einen europäischen Brand unvermeidlich machen“ (M.5, Z.5). Sollte dieser Fall eintreten, so hoffte Deutschland, dass England neutral bleiben würde. Diese Forderung wurde von der englischen Seite ausdrücklich abgelehnt (M6, Z.2-3).
Auch das Kooperieren mit Russland zeigte keine Wirkung. Das Zarenreich bemühte sich um Verhandlungen mit Österreich-Ungarn und bat Deutschland um eine Intervention in Wien (M9, Z.4). Obwohl die deutsche Führung dieser Bitte entgegenkam, verweigerte der Bündnispartner jegliche Teilnahme an solchen Konversationen (M.10, Z.3). Da derartiges Eingreifen ein direkter Widerspruch zum „Blankoscheck“ war, kann man das Verhalten Österreichs in dieser Situation nachvollziehen. Der Verlauf der Verhandlungen in dieser Form lässt Russland also trotz der Teilmobilmachung am 29.7. in einem besseren Licht stehen, als Österreich-Ungarn.
Die Versuche, den Konflikt lediglich auf Balkan zu beschränken bzw. das Bemühen um eine gar friedliche Lösung, waren fehlgeschlagen. Darauf folgten ultimative Forderungen Deutschlands an Russland und Frankreich, auf die die besagten Großmächte nicht eingingen. Das führte zu Kriegserklärungen von Deutschland und England und so begann am 1.8.1914 der Erste Weltkrieg.
Angesichts der angeführten Schilderung und Argumentation wird ersichtlich, dass alle Fäden auf der Suche nach Antworten zu der Kriegsschuldfrage größtenteils in Deutschland zusammenlaufen. Die besonders aggressive Außenpolitik in einem sowieso spannungsgeladenen europäischen Raum war ein unnötiger Reizfaktor. Der gesamte politische Kurs setzte sich aus vielen kurzsichtig geplanten Fehlentscheidungen, die das Ansehen Deutschlands immer weiter verschlechtert hatten. Dies führte letztendlich zur fast vollständigen Isolation um 1914. Nach dem Attentat in Sarajewo war die Lage dramatisch, und um nicht völlig alleine dazustehen, versprach Deutschland seinem letzten Bündnispartner unbedingte Treue in Form des Blankoschecks. Im Verlauf der Julikrise stellte sich das als ein großer Fehler heraus, da alle späteren Handlungen der Regierung durch diese Entscheidung erheblich eingeschränkt waren.
Alle Verhandlungen, die Deutschland im Juli 1914 geführt hat, waren entweder von demonstrativer Ablenkung von der Schuld oder von verzweifelten Anstrengungen zur Begrenzung des Konflikts geprägt. Die Absicht, den Weltkrieg ernsthaft zu vermeiden, ist jedoch in keiner der Quellen deutlich erkennbar.
Die letzte Aussage gilt allerdings nicht nur für Deutschland: Keine der Großmächte hat effektiv etwas gegen die Ausbreitung des Konflikts unternommen. Zwar war die Hoffnung auf eine friedliche Lösung an manchen Stellen angedeutet, doch niemand hat den Teufelskreis durchbrechen wollen – die Regierungen waren zu sehr mit der Verfolgung ihrer Interessen und der Schuldverschiebung beschäftigt. (Semjon Kaul)